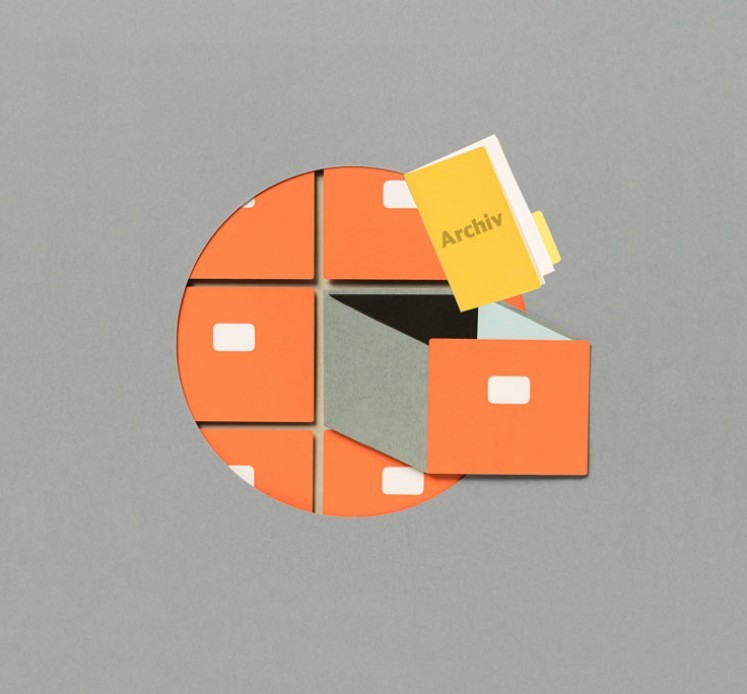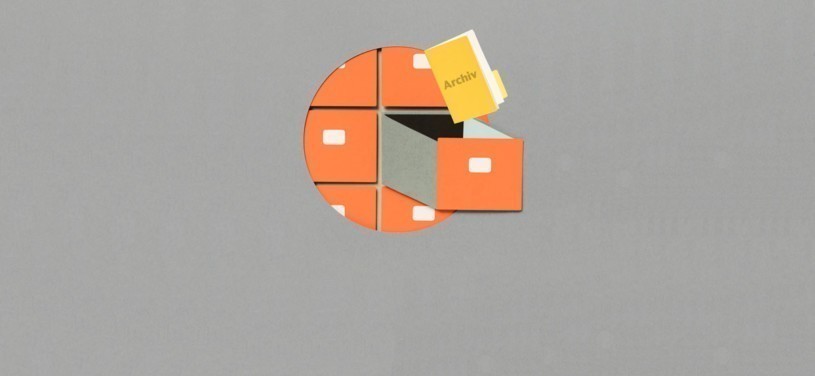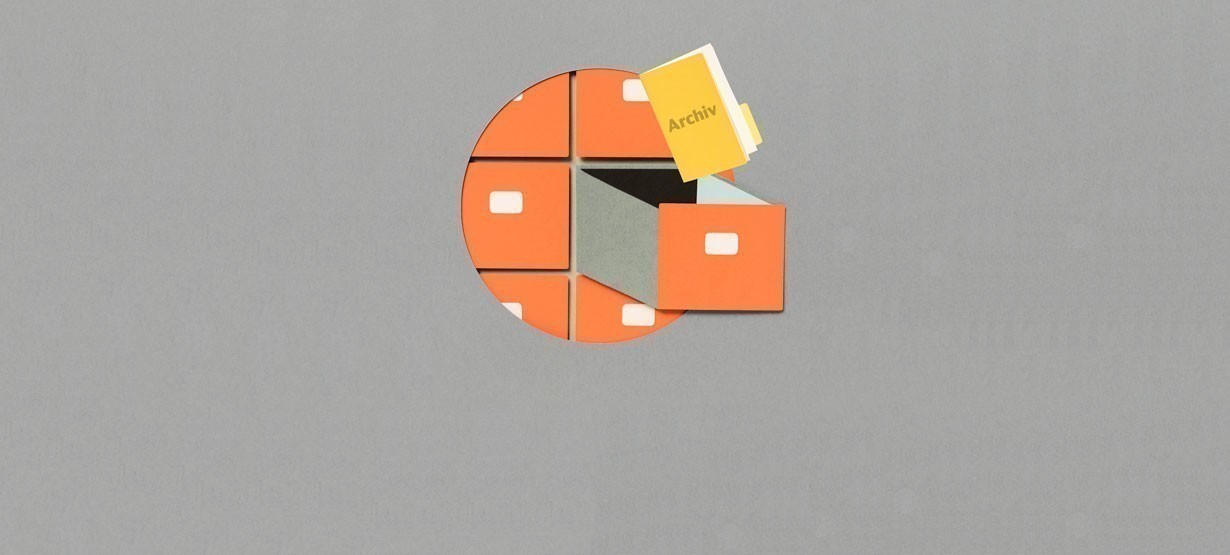
Fehlerkultur
Versuch macht kluch
Ein Lob dem Irrtum, scheitere erfolgreich, denn ohne Fehler kein Fortschritt – so lauten die Slogans, die eine neue Fehlerkultur propagieren. Doch was bewirkt sie? Und ist die deutsche Wirtschaft schon bereit dafür?
Na, wie cool sind Sie? Waren Sie – oder zumindest einer Ihrer Kollegen – kürzlich auf Pilgerfahrt im Silicon Valley? Tragen Sie nun lässigere Kleidung im Büro? Nutzen Sie Begriffe wie „goal digger“, „predictive analytics“ und „smarketing?“ Wollen junge Data-Scientists ein stellen? Und überhaupt, muss nicht dringend eine neue Fehlerkultur im Unternehmen etabliert werden?
Für jedes Ja dürfen Sie sich fünf Punkte gutschreiben. Weitere fünf, wenn der Holzfällerbart schon wieder ab ist. Und noch einmal fünf, wenn Sie gemerkt haben, dass dieser Test nicht ganz ernst gemeint war. Denn die Adaption der Prinzipien des Silicon Valley könnte was sein? Ein Fehler, genau. Wie sagte schon Siemens-Chef Joe Kaeser? „Man muss das Silicon Valley kapieren, nicht kopieren.“ Fehler zu machen gilt dennoch derzeit als schwer angesagt. Schon 2007 widmete das Wirtschaftsmagazin „Brand Eins“ dem „Felher“ eine Titelseite. In den Jahren darauf quollen die Ratgeberregale beinahe über: „Lernen aus Fehhlern: Wie man aus Schaden klug wird“, „Lob des Irrtums – Warum es ohne Fehler keinen Fortschritt gibt“ oder „Gescheiter scheitern – Eine Anleitung für Führungskräfte und Berater“. Parallel etablierten sich in Berlin und Hamburg die „FuckUp Nights“ – Abende, an denen Gescheiterte davon erzählen, wie sie ihre Geschäftsidee versemmelt haben.
Über Fehlerkultur wird in Deutschland also intensiv nachgedacht. Der Grund dafür ist simpel: Fehlschläge sind im Silicon Valley – jenem 80 Kilometer langen und 20 Kilo meter breiten Küstenstreifen südlich von San Francisco – angeblich Teil der sonnigen Lebens und Arbeitsphilosophie. Und die Unternehmen, die dort residieren, Apple, Facebook, Google, nun mal die derzeit reichsten und mächtigsten der Welt.
Wenn also in der Facebook-Zentrale, von der aus mehr als 1,4 Milliarden Menschen erreicht werden, gerahmte Appelle wie „Fail harder“ die Wände zieren, kann man ins Grübeln kommen. Was ist überhaupt ein Fehler? Ist Scheitern wirklich toll? Was kann man gebrauchen, was nicht?
Was ist ein Fehler?
Die Fragen klingen simpel. Ihre Antworten sind jedoch tückisch. Das beginnt bei der Fehlerdefinition. Mal tritt er bei Dingen auf, einer Autopanne etwa; mal bei Menschen, etwa jenen, denen es an Führungskraft mangelt. Häufig wird er erst bei konkreten Handlungen Einzelner sichtbar, seine Ursache liegt aber in der Konstruktion darunter. Auch seine Bewertung ist diffizil – ein falsches Wort im Diktat hat eine andere Qualität als eine falsch analysierte Blutgruppe. Schließlich ist oft unklar, wer darüber bestimmt, was als Fehler gilt, was nicht.
„Nichterfüllung einer festgelegten Anordnung“ – so lautet die etwas ruppige, aber letztlich nichtssagende Definition gemäß der DIN-Norm ISO 9000 für Qualitätsmanagement. Was wohl Christoph Kolumbus gesagt hätte, hätte diese Norm schon 1492 gegolten? „Männer,das ist nicht Indien, also weiter. Und ja kein Wort zur Majestät!“ Denn der Seefahrer verfehlte sein Ziel, die Seeroute zu lukrativen Handelszielen im Fernen Osten. Was für die zufällige Entdeckung Amerikas gilt, gilt analog auch für Teflon, Eis am Stil, Penicillin, die Fixierung von Fotos oder PostitKleber.
Fehler können demnach produktiv sein. Oder harmlos. Aber auch tödlich. Eines sind Fehler immer: menschlich. Und: unvermeidlich. Da nicht zu verhindern, stellt sich die Frage, wie darauf reagiert wird.
Null Fehler als Unternehmensziel
„In den Achtzigerjahren wurde auf meine Anfrage nach Untersuchungen in deutschen Unternehmen oft geantwortet: ‚Fehler passieren in diesem Unternehmen nicht’“, sagt Professor Michael Frese, der an den Universitäten von Lüneburg und Singapur Management und Organisation lehrt. „Heute sind die Unternehmen offener für die Frage, wie man das Problem in den Griff bekommt, aus Fehlern lernen und so Qualität verbessern kann.“
Denn Fehler kosten meist Geld – von der falsch notierten Lieferadresse bis zur aufwendigen Rückrufaktion. Von daher fließt gerade in deutschen Unternehmen enorm viel Zeit und Energie in die Planung, um Abläufe und Produkte so perfekt wie möglich zu machen. Der deutsche Maschinenbau-Konzern Schaeffler über sein Selbstverständnis: „Das Ziel unserer Qualitätspolitik erschöpft sich nicht darin, fehlerhafte Produkte zu entdecken und auszusortieren. Unser Qualitätsdenken sorgt vielmehr dafür, dass Fehler erst gar nicht entstehen. Null Fehler ist deshalb das erklärte Unternehmensziel.“
Dieses auch als ballistisch bezeichnete Denken ist ökonomisch durchaus sinnvoll. Fehlerkosten steigen exponentiell – je länger ein Fehler unentdeckt bleibt, umso höher werden die Kosten zu seiner Behebung. Was in der Planung mit einem Euro in der Bilanz aufläuft, beziffert sich in jeder weiteren Stufe – Entwicklung, Arbeitsvorbereitung, Fertigung sowie beim Kunden – etwa um den Faktor Zehn.
Allerdings ist bekanntlich nichts ohne sein Gegenteil wahr. Statistiker kennen den Pareto-Effekt, der besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden – je näher man den 100 Prozent kommen will, desto mehr Aufwand ist gefordert. Weshalb heute in vielen Fällen Software-Anwendungen beim User reifen – „Done is better than perfect“, auch dieses Motto hängt bei Facebook an der Wand. Erfolg macht zudem konservativ – warum sollte man das eigene Handeln kritisch analysieren? Schließlich trägt auch eine Firmenkultur der Angst dazu bei, unbeweglich zu werden: Wer sich ständig davor fürchtet, einen Irrweg einzuschlagen, wird nichts Neues ausprobieren. Untersuchungen zufolge sind bis zu 60 Prozent firmeninterner Mails sogenannte Cover-your-Ass-Mails, mit denen der Absender belegen kann, dass er nicht allein verantwortlich ist, wenn etwas schiefgegangen ist.

Konkreter Raum für Fehler
Nun ist das alles so neu nicht. Schon Konfuzius wusste: „Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“ Henry Ford ergänzte: „Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ Und von der aus Deutschland vertriebenen Marlene Dietrich stammt das schöne Bonmot, dass sie in einem zukünftigen Leben dieselben Fehler begehen würde, „nur ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe“.
Gerade in Deutschland dominiert aber vielfach noch eine Fehlerkultur, die früheren autoritären und bürokratischen Strukturen entspringt. In ihr sind Fehler negativ besetzt, sie werden schon in der Schule bestraft und zählen oft mehr als ein kreativer Lösungsansatz. Doch wer zu großen Wert auf Sicherheit, auf Fehlervermeidung legt, verhindert Innovation. So verläuft die Entwicklung von Kleinkindern auch deshalb so rasant, weil sie einen Fehler nach dem anderen machen – und daraus lernen, sich weiterzuentwickeln.
Dementsprechend und nach dem Modell des Silicon Valley haben zahlreiche Großunternehmen Modelle entwickelt, in denen sie nicht nur Fehler, sondern ein völliges Scheitern zumindest einkalkulieren. Der Versicherer Allianz rief die Allianz Digital Accelerator GmbH ins Leben mit dem Ziel, neue Geschäftsmodelle auf Basis digitaler Technologien zu entwickeln. Mit dem „d.lab“ hat die Deutsche Bahn ein Zukunftslabor eingerichtet, in dem Mitarbeiter neue Ideen entwickeln und Dinge ausprobieren können, von denen niemand weiß, ob sie sich im Markt jemals durchsetzen werden.
Fehlerkultur braucht Feedback-Kultur
Ähnliche Gründungen existieren inzwischen in vielen deutschen Unternehmen, die den Geist des Silicon Valley zumindest als innovationsfördernd erkannt haben. Auf der operativen Ebene wurde vielfach ein Fehlermanagement integriert. Nicht als Aufruf zur Schlampigkeit, sondern mit dem Ziel, bestehende Abläufe zu überprüfen, zu verbessern oder auch zu erneuern.
Im konkreten Umgang mit Mitarbeitern zählen jedoch andere, weniger messbare Dinge: Entscheidend ist zuerst, Stress zu reduzieren, gezielt Tempo herauszunehmen – denn in Stresssituationen fallen ganze Hirnregionen aus, was häufig zu weiteren Fehlern führt. Darüber hinaus müssen gerade Führungskräfte als Protagonisten auftreten. Was bedeutet, dass sie persönliche Schuldzuweisungen vermeiden, gemeinsam mit dem Verursacher nach den Gründen suchen, in gewissen Fällen gar loben sollen.
Für einen offenen Umgang mit Fehlern plädiert Alexander Birken, Vorstandsmitglied der Otto Group, „denn Fehler offenbaren, wo es Optimierungspotenziale gibt. Untersuchungen der Universität Gießen haben schon vor Jahren ergeben, dass ein falscher Umgang mit Fehlern ein Unternehmen bis zu 20 Prozent an Profitabilität kosten kann. Das könnten wir uns in unserem herausfordernden Marktumfeld gar nicht leisten.“ Das Handelsunternehmen hat sich in den letzten 20 Jahren, seit dem Durchmarsch des E-Commerce, stark verändert. Das Credo lautet: „Wir irren uns empor.“ Natürlich wird noch immer Damenoberbekleidung ausgeliefert. Längst aber werden auch über Startup ähnliche Strukturen Software-Lösungen entwickelt, etwa „Risk Ident“, ein Programm zur Betrugsprävention, das inzwischen von der Schufa lizenziert wurde.
„Einer der wesentlichen Hebel für eine Fehlerkultur besteht in einer guten Feedback-Kultur“, ist der Otto-Vorstand überzeugt. „Führungskräfte geben regelmäßig ihren Mitarbeitern ein Feedback, erhalten aber auch von den Mitarbeitern eine Rückmeldung. Gerade dieses Feedback wird nur in wenigen Unternehmen ernsthaft praktiziert.“
Bei allen Annäherungen: Noch immer unterscheidet sich die Fehlertoleranz dies und jenseits des Atlantiks erheblich. „In den USA gehen Sie in den zweiten Stock des Verwaltungsgebäudes, um Insolvenz nach Chapter 11 anzumelden“, sagt Joe Kaeser, der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG. „Und anschließend in den dritten Stock, um ein neues Unternehmen anzumelden. In Deutschland sind Sie gesellschaftlich geächtet.“
Erfahrungen sammeln, Fehler vermeiden
Doch auch hier ändern sich die Parameter. Sie ändern sich mit der fortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft. „Sie macht es notwendig, zügig neue Konzepte zur Marktreife zu bringen. Um das zu schaffen, brauchen Sie Mitarbeiter, die unternehmerisch denken“, sagt Alexander Birken von Otto. Nicht jedes Risiko lasse sich im Vorwege ausmerzen und nicht jede Entscheidung bis ins kleinste Detail auf ihre Richtigkeit durchleuchten. „Wir bringen auch mal Geschäftskonzepte an den Markt und testen im Live-Betrieb, ob sie tragfähig sind.“
So kopiert die deutsche Wirtschaft zwar nicht das vom Startup-Spirit getragene Valley, aber sie kapiert – Trial and Error –, welche positiven Impulse daraus erwachsen. Von einer neuen Fehlerkultur zu sprechen wäre allerdings verfrüht. Tatsächlich wird das Scheitern im Einzelfall ja fast immer als brutal erlebt – ob beim Ende einer Liebesbeziehung oder beim Einstellen eines Projektes.
Die Heroisierung des Scheiterns wird daher in der Regel gerne von jenen betrieben, die zugleich eine Erfolgs-, gar eine Auferstehungsgeschichte mitliefern können. Für die Annahme jedoch, dass Fehler, Lernen und Erfolg automatisch miteinander verknüpft sind, gibt es keinen empirischen Beleg. Wer deshalb beschließt, auf das Lernen zu verzichten, begeht allerdings einen dicken Fehler. Denn die Wirtschaft bietet immer wieder Chancen, folgt keiner linearen Logik, sondern nach Schumpeter dem Prinzip der schöpferischen Zerstörung: Wenn auf der einen Seite etwas erschaffen wird, wird auf der anderen Seite etwas vernichtet.
Was bleibt, ist eine simple Erkenntnis: Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht. Die Frage an den Manager heißt deshalb: Wie oft veranstalten Sie kurze Mistake Meetings oder führen Not-to-do-Listen? Sind Fehler, die Ihre Mitarbeiter machen, automatisch auch Ihre Fehler? Kurz gefasst, wie konstruktiv gehen Sie mit Fehlern um? Oder, anders gefragt: Wie cool sind Sie?