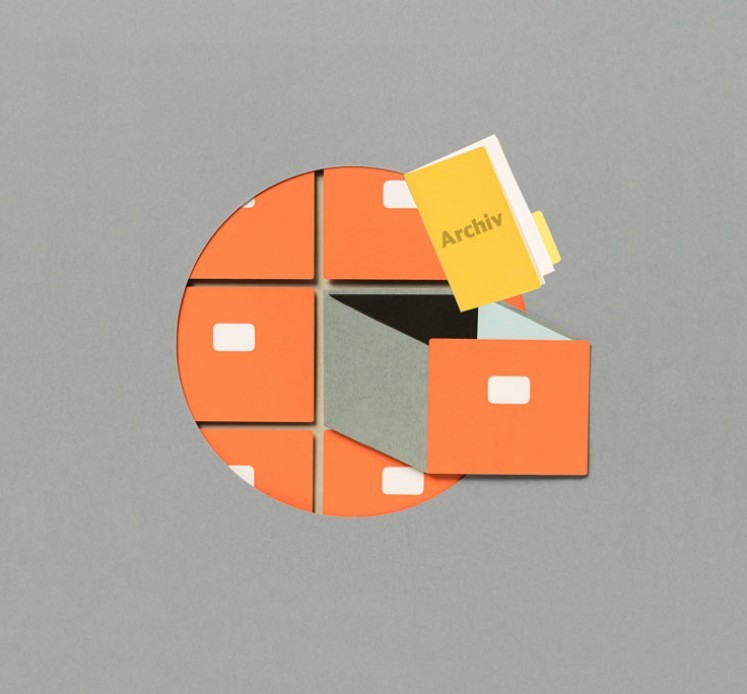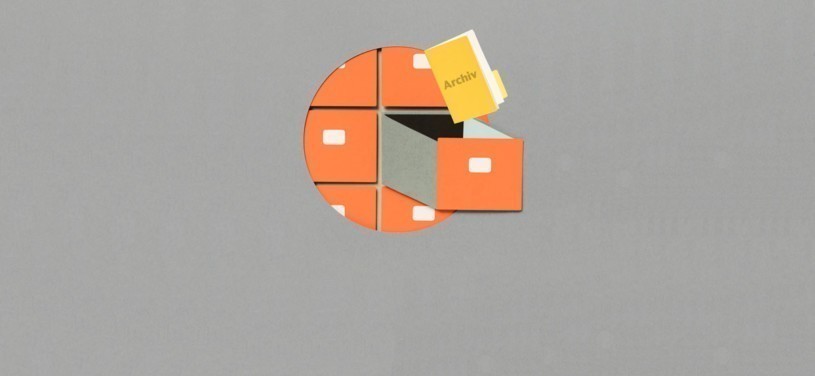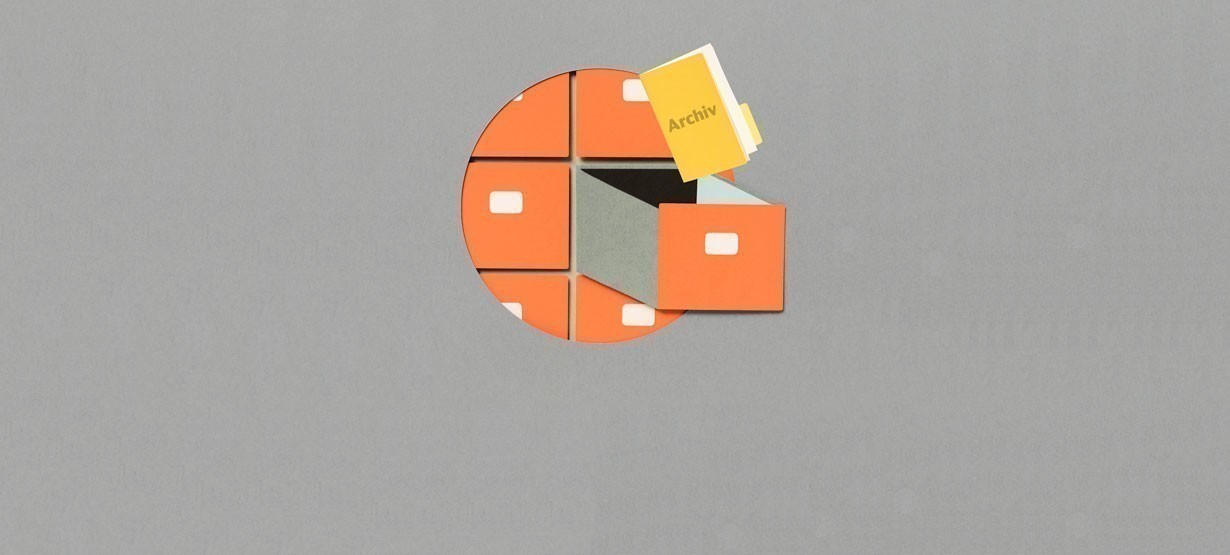
Arbeitswelt
Start me up!
Um im Wettbewerb zu bestehen, öffnen sich immer mehr Großunternehmen für die Methoden von Start-ups. Oder gründen selbst Firmen, die Innovationen versprechen.
Sie sprachen mit Landwirten, führten an die 100 Interviews, bis sie an einer entscheidenden Frage hängen blieben: Ist es möglich, den Spargel mithilfe von Sensoren beim Wachsen zu beobachten? Das war Mitte Februar 2015, und es war höchste Zeit: „Erst auf den zweiten Blick wurde uns klar, wie ambitioniert unser Ziel war”, erinnert sich Informatiker Christian Lasarczyk. „Die Spargelsaison beginnt Anfang April. Wenn man dann mit seiner Lösung nicht beim Kunden ist, wartet man unter Umständen auf die nächste Saison. So viel Zeit hatten wir nicht.”
In sechs Wochen gelang es seinem Team, ein erstes minimales Produkt auf die Beine zu stellen – eine Smartphone-App, die verbunden mit Sensoren im Feld die Bauern mit den Temperaturdaten versorgen kann. Der Vorteil: Die können damit im idealen Moment die Ernte beginnen.
Die App ist das erste Produkt eines Start-ups, das weder aus einem Berliner Hinterhof noch aus einem Gründerzentrum hervorgegangen ist. Deepfield Robotics, so der Name, sitzt in Ludwigsburg – ganz in der Nähe des großen Bruders, des Unternehmens Bosch mit 300 000 Mitarbeitern.
Eine Konstruktion, wie sie gerade deutschlandweit Schule macht. Denn immer mehr Konzerne sehen sich aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit der Märkte dazu gezwungen, die Vorzüge der Start-up-Kultur in ihre Strukturen zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Fast jeder DAX-Konzern profitiert inzwischen wie Bosch von einer firmeneigenen Gründerzelle. Auch die Deutsche Bahn sucht z.B. mit ihrem Innovationslabor d.lab nach Ideen für neue Mobilitätskonzepte. Damit ist sie in guter Gesellschaft. 43 Prozent der deutschen Mittelständler kooperieren mit einem Jungunternehmen. Eine aktuelle Studie des Berliner Beratungsunternehmens etventure und der Gesellschaft für Konsumforschung bestätigt den Megatrend. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich Firmen, die mit Gründern kooperieren, besser auf die digitale Transformation vorbereitet sehen. Von dem Schulterschluss erhoffen sich die befragten Manager aus 2000 deutschen Großkonzernen insbesondere Zugang zu neuen Technologien, schnellere Innovationen sowie einen Einblick in die Methoden von Gründern.
„Wir erleben in der Industrie immer mehr Dynamik und Komplexität”, erklärt Peter Guse, Leiter des Bosch-Inkubators, den man modisch „Grow” getauft hat. „Das hat sich in den letzten zehn Jahren extrem zugespitzt. Immer mehr Produkte müssen sich in einer immer kürzeren Zeit auf dem Markt behaupten. Das passt nicht gut zu Unternehmen mit strikten Hierarchien, die über viele Jahre Organisationen und Prozesse aufgebaut haben, die das traditionelle Kerngeschäft absichern und stärken sollen. Daher sind wir heute in zunehmendem Maße darauf angewiesen, dass viele Experten bei relativ einfachen Strukturen zusammenarbeiten und möglichst schnell zu Lösungen kommen.”
Auf den Fluren von Deepfield Robotics, für die mittlerweile weltweit 120 Menschen arbeiten, wird die andere Kultur für die Manager aus dem Konzern offensichtlich. Sie sehen Vernetzung statt Hierarchie, was bedeutet, dass zügig quer kommuniziert wird, also über langsame, vertikale Strukturen hinweg. Sie sehen ein flexibles Arbeitsplatzmodell, nach dem Mitarbeiter – jenseits der gelernten Präsenzkultur – entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Sie beobachten ein Klima der Offenheit bei den unter einem Dach arbeitenden Teams. Es gibt keine Wände; was an den Pinnwänden hängt, ist für alle sichtbar. Sie sehen die Verbindung von Theorie und Praxis, indem die Werkbänke und die Schreibtische unweit voneinander in einem Gebäude stehen und ständig irgendwelche Mitarbeiter vom Realitäts-Check beim Kunden zurückkommen oder dorthin ausschwärmen. Und sie sehen den Mut zu scheitern, gepaart mit dem Willen, aus Fehlern zu lernen. Und manchmal führen Fehler zu einem anderen ungeplanten Ergebnis. So stieß das Team um Christian Lasarczyk erst im zweiten Anlauf auf die Idee für eine sensorgestützte App zum Spargelernten. Ursprünglich wollte es für die Bauern einen Ernteroboter entwickeln. Doch kein Bauer war bereit, sich eine teure Maschine anzuschaffen, die er nur zehn Wochen im Jahr brauchen würde.
Ob die Mutter Bosch allerdings bereit ist, eine der wichtigsten Lehren ihres Tochterunternehmens anzuwenden und damit ihren bisher sieben Start-up-Entwicklungen zu noch mehr Größe zu verhelfen, muss sich erst zeigen. Diese zentrale Lehre heißt: schnelles Wachstum. Sie beißt sich deshalb so mit den Gebräuchen deutscher Unternehmen, weil mit ihr Erfolg nicht wie hierzulande üblich über den Ertrag gemessen wird, sondern über den Marktanteil. Anders gesagt: Bevor eine App Gewinne abwirft, muss erst stark in deren Ausbreitung investiert werden, damit kein Konkurrent dem neuen Produkt einen ernst zu nehmenden Rivalen ins Segment setzen kann.
Ein gutes Beispiel dafür ist Amazon. Seit mehr als 20 Jahren macht der Internet-Versandhändler, der als kleines Start-up begann und heute ein Unternehmen mit 100 Milliarden Dollar Umsatz ist, kaum Gewinn; er besetzt aber ein Monopol und könnte dadurch in naher Zukunft Milliardengewinne einstreichen. „Da sind wir bisher Opfer unserer Tradition unter dem Motto: ›Die Firma ist so viel wert, wie sie verdient.‹ Am Ende haben oft die Amerikaner investiert “, bedauert Start-up-Experte Udo Schloemer. „Das ist ein kulturelles Thema. Wir müssen die Tugenden der Deutschen, also den maximalen Qualitätsanspruch, verbinden mit der amerikanischen Kultur des Scheiterns und des Wachsens. Das ist der Schlüssel.”
Schloemer ist Gründer und Geschäftsführer der Factory. Im Herzen Berlins stellt er den großen und kleinen Revoluzzern der Wirtschaft einen stetig wachsenden Campuskomplex zur Verfügung und bietet Events, die es erlauben, Netzwerke zu bilden. So will er die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft als Gegengewicht zum Silicon Valley fördern. Schloemer sieht die Ansätze der Konzerne, firmeneigene Start-up-Teams zu etablieren, allerdings kritisch. „Man kann in einer bestehenden Struktur keine Innovation durchsetzen, weil darin zu viele Leute stecken, die aus ihrer Erfahrung heraus vieles nicht für möglich halten. Auch die Manager haben oft nicht den Zugang zur Digitalisierung und damit zur Innovation, weil sie nicht damit aufgewachsen sind.”
Deshalb würden die meisten Hausinkubatoren zu stark am bestehenden Management hängen, das in der Regel zu früh eingreife. Fehler würden nicht zugelassen. Boschs Spargelabenteuer sei da sicher ein Positivbeispiel, doch eher die Ausnahme. „Selbst den Gründervätern von Siemens, Daimler oder Bosch würde das heutige Management kein Geld zur Verfügung stellen, weil es glaubte, die seien verrückt. Man hat sich in über einhundert Jahren vor allem darauf konzentriert, bestehende Dinge zu optimieren, anstatt sie infrage zu stellen.”
Doch für einige Großunternehmen ist längst eine neue Zeitrechnung angebrochen. So kündigte Daimler-Chef Dieter Zetsche Ende vergangenen Jahres an, 20 Prozent seiner Belegschaft in einer „Schwarmorganisation” arbeiten zu lassen. Heißt: Autonom arbeitende, nicht an strikte Hierarchien gebundene Mitarbeiter sollen über Abteilungsgrenzen hinweg verknüpft werden und damit leichter zu Ideenumsetzung und Problemlösungen kommen. „Das ist keinesfalls auf einzelne Projekte beschränkt, sondern eine dauerhafte Sache”, versicherte der Konzernlenker.
Visionär Schloemer, der selbst Firmen aufbaute und große Unternehmen beriet, hält eine möglichst große Unabhängigkeit vom Haupthaus für entscheidend. Der Nährboden für Innovationen sei eine eigene Community, die sich im Austausch mit unterschiedlichen Marktteilnehmern inspirieren lasse, sich an Firmen beteilige oder Start-ups übernehme. Lange Sitzungen am Konferenztisch wären bei den immer kürzer werdenden Produktionszyklen nicht zielführend, glaubt Schloemer, der mit seiner Factory Prozesse beschleunigen will. „Auf unserer Plattform bringen wir Mittelständler, Industrieunternehmen und DAX-Konzerne mit Gründern zusammen, damit sie – ob online oder in unseren Klubhäusern – in ständigem Dialog stehen.”
Inzwischen hat die Factory über eintausend Mitglieder. Die unangepassten Revoluzzer der Generation Y drängen nach Berlin. Eigentlich ein wunderbares Biotop für die deutsche Unternehmerelite, sollte man meinen. Doch noch fehlt oft der Mut der etablierten Manager, sich in diese neue Welt hineinfallen zu lassen. Noch ruft die Haltung vieler Gründer, mit einer Erfindung zuerst die Welt verändern zu wollen und dann erst Geld zu verdienen, Irritationen hervor. So erlebt Schloemer statt großer Erweckungserlebnisse oft das andere Extrem. „Ich sehe noch immer ein großes Maß an Ignoranz und Arroganz. Die Manager begegnen den jungen Menschen oft nicht auf Augenhöhe, sondern stehen auf der Position, dass sie es sind, die fordern und die Regeln bestimmen. Brutal gesagt: zu wenig Unternehmertum, zu viel Management.”
Der Kulturwandel in der Wirtschaft ist zwar in vollem Gange, aber längst nicht überall ein Selbstläufer. Schade eigentlich, denn der Zeitpunkt für die digitale Attacke scheint – gerade in Deutschland – ideal. Waren in den vergangenen Jahren meist Jungunternehmen erfolgreich, die softwaregetriebene Geschäftsmodelle aus dem E-Commerce optimierten, wartet nun der klassische Maschinenbau auf seine Digitalisierung. Das „Internet der Dinge”, die intelligente Vernetzung von Geräten also, könnte für die Ingenieursnation Deutschland die Gelegenheit sein, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Aber eben nur dann, wenn es schnell geht. Bei der Spargel-App könnte es klappen. Das Interesse der Bauern für die Smart-Farming-Anwendung ist nach der ersten Erntesaison rasant gestiegen.