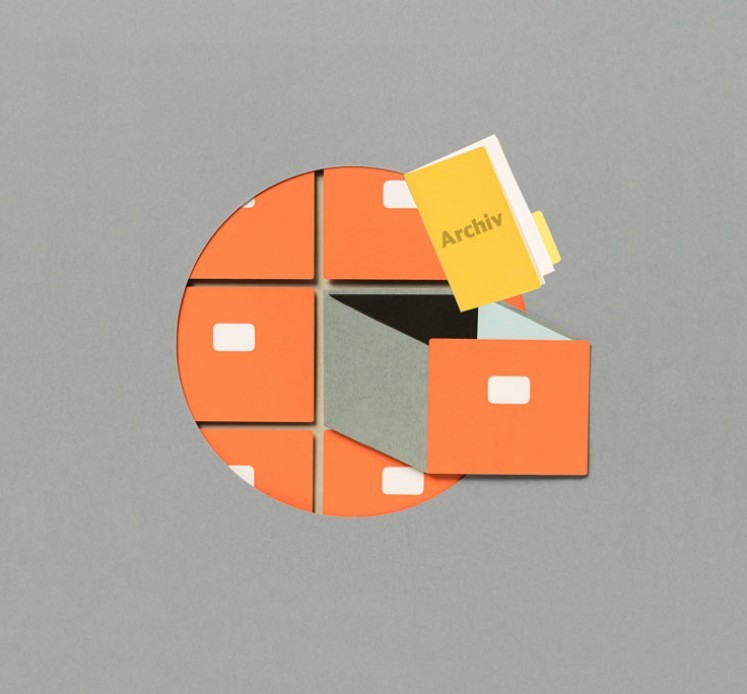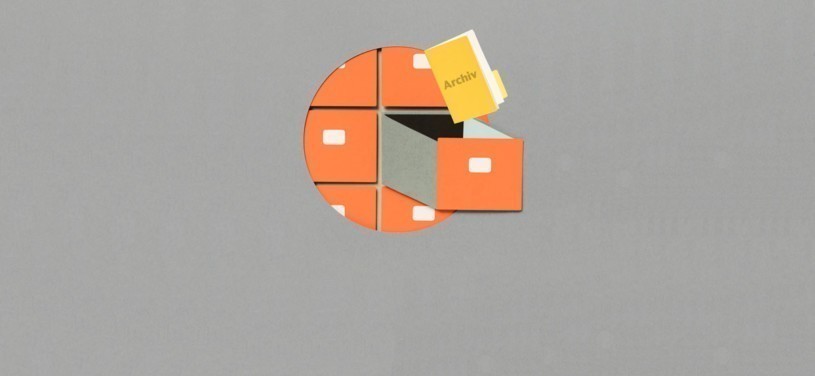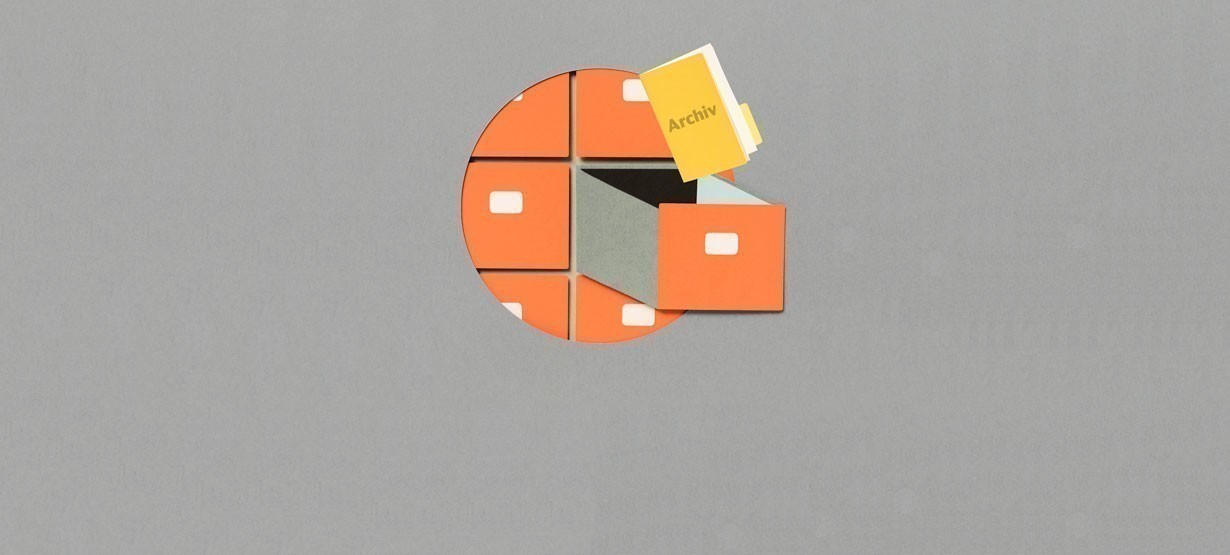
Leistung
Höher, weiter, schneller
Unser Verhältnis zur Leistung ist getrübt. Dabei kann sie eine Quelle von Glück sein. Zeit für eine Neubewertung, findet Autor Uwe Pütz.
Als der Mann die Haustür öffnet, ergreifen Nagetiere die Flucht. Von den Wänden bröckelt der Putz, Spinnweben hängen von der Decke, der Fußboden – nur Staub und Dreck. Und der Mann? Öffnet einen Wasserhahn, wo keiner ist, liegt Probe auf einer Abdeckplane. „Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es auch bauen“, heißt der Werbeslogan einer Baumarktkette dazu. Ein Versprechen wie maßgeschneidert für Millionen von Deutschen, die sich Woche für Woche mit Lust und Tatkraft ans Werk machen.
Auf ein Neues? In den Büros und Produktionshallen können viele Unternehmen von dieser Begeisterung nur träumen. 67 Prozent der Mitarbeiter in deutschen Firmen machen „Dienst nach Vorschrift“, wie das Beratungsunternehmen Gallup nach einer Umfrage 2014 veröffentlicht hat. 17 Prozent gaben sogar an, innerlich gekündigt zu haben. Sie können es sich nicht vorstellen, mehr als das Nötigste zu tun, sich ins Zeug zu legen und kraft ihrer Leistung neue Aufgaben zu bewältigen. Hat ein Teil der Deutschen jede Lust auf Leistung verloren?
Leistung und Lust? Klingt wie eine Erfindung aus den Denkfabriken der Motivationstrainer. Liegt da nicht ein anderer Gedanke nahe: Leistung gleich Anstrengung und Stress? Ein Muss statt ein Möchte? Und bringen Parolen wie „Da geht noch mehr“ oder „Das Bessere ist des Guten Feind“ nicht sofort hartnäckige Fragen in Stellung: Wieso? Weshalb? Warum? Ja, warum eigentlich? Der Begriff ist wie von zwei magnetischen Feldern umströmt, zwischen Arbeit und Trägheit, Fleiß und Faulheit. Lust und Unlust. Für den Verhaltensforscher und Unternehmensberater des Instituts „Biologik“, Klaus Dehner, hat bisher noch immer die Lust gesiegt. Schon in der Frühzeit mussten sich unsere Vorfahren gehörig auf die Hinterbeine stellen, um gegen Unwetter, Fressfeinde und Mitbewerber zu bestehen. Hier liegt der Ursprung für zwei elementare Antriebskräfte: der Wille zu überleben und der Wille, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Wer als Sieger hervorging, dem war große Anerkennung seiner Gruppe sicher.

Während ein Teil der Beschäftigten im „Nine to five“-Rhythmus seinen Job erledigt, bewegt sich ein anderer hart am Limit. „Die Arbeit wird auf immer weniger Schultern verteilt“, beobachtet Management-Trainer Ulf Posé. Mit der Auflösung der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit laufen Mitarbeiter und Führungskräfte Gefahr, sich zu verausgaben. „Wir drehen uns immer schneller im Hamsterrad und haben uns völlig dem Leistungsdiktat unterworfen“, attestiert der Psychologe Stephan Grünewald unserer Gesellschaft. Am Ende stehe der Burn-out, die „Erschöpfungsmedaille“ der besonders Tüchtigen.
Nach einer lustvollen Beziehung klingt das nicht. Wie auch – ist unser Verständnis von Leistung doch von Prämissen durchsetzt, die eine Neubewertung erschweren.
Leistung als Last
Leistung macht Arbeit, und die kann ein Kreuz sein. Mit dem Maschinenzeitalter transportierten sich die Bilder von Werktätigen, die in Fabriken und Kohlegruben Schwerstarbeit verrichteten. Die Vorstellung, dass ein gutes Ergebnis nur mit harter Schufterei zu erzielen ist, beeinflusst seit Jahrhunderten unser Leistungsbild. „Von der Stirne heiß‘ rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben“, proklamierte schon Friedrich Schiller, lange bevor Max Weber die ethischen Grundlagen pflichtschuldiger Arbeit analysierte. Mit dem 19. Jahrhundert verbreitete sich der Glaube, der Mensch tue gut daran, zu Gottes Wohlgefallen den irdischen Aufgaben nachzugehen. Die dürfen ruhig anstrengend sein, denn: Ohne Fleiß kein Preis.

So entstehen Effekte wie Zeitschinden oder Aktionismus, denn es ist besser, viel Zeit mit wenig Arbeit zu verbringen, anstatt alles in kurzer Zeit zu erledigen. Wer spätabends über einer Präsentation brütet, macht Eindruck; wer eine Aufgabe bis zum Mittag gelöst hat (und dann geht), ist verdächtig. So wird das Beschäftigtsein – das Schuften – zum Leistungsnachweis und nicht das Erreichen eines Ziels – eine Praxis, die zunehmend infrage gestellt wird. Und sicher eines nicht auslöst: Lust auf Leistung.
Leistung lohnt sich
Der Glaubenssatz zieht eine breite Spur der Frustration nach sich. Dabei ist er so unbegründet nicht. Nach dem Motto „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ schwelte im Nachkriegsdeutschland für zwei Jahrzehnte die Hoffnung, ein jeder könne es zu etwas bringen, wenn er nur kräftig genug in die Hände spuckt. Der Traum, bis ganz nach oben aufsteigen zu können, ist inzwischen der Erkenntnis gewichen, dass nicht in erster Linie Leistung, sondern Vermögen Reichtum schafft. In einer Infas-Umfrage von 2011 sagten 62 Prozent der Deutschen, dass sich Leistung nicht mehr lohne. Für Ulf Posé beruht die Grundannahme auf einem Missverständnis. „Leistung war noch nie Ursache der Entlohnung, denn Leistung und der Nutzen für ein Unternehmen haben wenig miteinander zu tun; bezahlt wird aber der Nutzen.“
Tatsächlich aber ist dieser Nutzen, das verwertbare Ergebnis einer Anstrengung, in modernen Organisationen nur schwer messbar. Wie will man in Team- und Projektarbeit zurechnen, wer zu wie viel Prozent an einem Erfolg beteiligt ist? Obwohl eine leistungsgerechte Bezahlung kaum möglich ist, soll ebendiese die Antriebskräfte befeuern. Große Gehaltsunterschiede, so die Theorie, fördert den Wettbewerbsgeist der Mitarbeiter und stachelt zur Höchstleistung an. Dabei ist sich die Forschung heute darin einig, dass mehr Geld nicht zu mehr Leistung führt. Wichtiger ist, dass ein Mitarbeiter seine Bezahlung im Vergleich zu der seiner Kollegen als fair betrachtet. Darüber hinaus sind andere Zeichen der Wertschätzung wirkungsvoll, zum Beispiel die Anerkennung des Chefs oder Auszeichnungen im Team.
Neue Lust auf Leistung
Schaut man genauer in die Motivstruktur, erweist sich jeder Anreiz von außen als wenig nachhaltig, womit wir beim Kern des Problems angelangt sind: Der wahre Antrieb kommt aus uns selbst. Wurde uns schon in die Wiege gelegt. „So wie der Überlebens- und der Sexualtrieb, so steckt auch der Leistungstrieb tief in uns“, ist Verhaltensforscher Klaus Dehner überzeugt, „es ist die Neugierde, die uns immer wieder veranlasst, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.“
Dehner ist Anhänger des amerikanischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi, der in seinem Buch „Flow“ Menschen beschreibt, die sich extrem anstrengen und dabei großes Vergnügen, ja Glück, empfinden. Ein Felskletterer, der in der Wand hängt, weiß nicht, was über ihm als Nächstes kommt. Aber er will es wissen, und sobald er den Griff findet, verwandelt sich die Unsicherheit in die Gewissheit, die Herausforderung gemeistert zu haben. In diesem Gefühl des Gelingens liegt die Quelle für lustvolle Erfüllung.

Leistung macht Spaß
Wie lässt sich dieser Anspruch auf die Berufswelt übertragen? Und wie schafft ein Unternehmen Bedingungen, die den Mitarbeitern ermöglicht, solch befriedigende Erlebnisse mit ihrer Leistung zu erfahren? Eine Antwort darauf formuliert Kerstin Bund, Autorin des Buchs „Glück schlägt Geld“. „Wir wollen arbeiten. Nur anders. Mehr im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Wir lassen uns im Job nicht versklaven, doch wenn wir von einer Sache überzeugt sind (und der Kaffeeautomat nicht streikt), geben wir alles. Wir suchen Sinn, Selbstverwirklichung und fordern Zeit für Familie und Freunde.“
Sie selbst bezeichnet sich als Mitglied der Generation Y, jener nach 1980 Geborenen, die mit neuen Ansprüchen ins Berufsleben drängen. Manche von ihnen suchen ihre Selbstverwirklichung jenseits großer Unternehmen, um als digitale Nomaden überall auf der Welt an Projekten zu arbeiten, die sie gerade spannend finden; andere gründen Start-ups – oder fordern bestehende Organisationen zum Umdenken heraus. Im Kern lautet ihr Anspruch: weniger Fremd-, mehr Selbstbestimmtheit im Job. Partizipation an Entscheidungen statt Kontrolle und Ansage. Das wird Firmen umkrempeln, die in Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge um Fachkräfte ringen. Einige haben bereits darauf reagiert. So brachte die weltweit agierende Bahn-Tochter DB Schenker mit „Young DB Schenker“ ein Konzept ins Rollen, das die Personalentwicklung auf die neuen Anforderungen abstimmt. In Firmen wie Hermle (Maschinenbau) oder Wooga (Computerspiele) entscheiden Teams schon heute selbstständig, welche Aufgaben sie in welcher Zeit erledigen. Feelgood-Manager kümmern sich um das Wohl der Mitarbeiter und stehen bei Problemen zur Seite. „Das wird heute erwartet“, sagt Marie-Blanche Stössinger von Wooga. „Wir wollen die besten Leute gewinnen – und sie auch halten.“
Diese Mitarbeiter suchen eine Arbeit, die ihnen Freiräume bietet und Freude macht. Sie wollen Geld verdienen, ohne Reichtümer anzuhäufen, denn wichtiger als Geld ist der Sinn. „Die Sinnfrage ist extrem wichtig“, glaubt Klaus Dehner, „wenn die positiv beantwortet ist, erlebt man tiefe Befriedigung bis hin zum Glück.“
Schon mahnen Soziologen, die neuen Glückssucher würden einer besonders perfiden Form der Selbstausbeutung auf den Leim gehen: Das unternehmerische Ich müsse sich dauernd anstrengen und optimieren, um die selbst gesteckten Aufgaben zu erfüllen.
„Wenn wir uns immerzu unter Leistungsdruck setzen, sehe ich die Gefahr, dass wichtige Ressourcen unserer Fähigkeiten, Kreativität und Innovationskraft, verloren gehen“, sagt Stephan Grünewald, Autor des Buchs „Die erschöpfte Gesellschaft“. Selbst die Freizeit werde heute verplant, es bleibe kein Raum zum Innehalten. Sein Plädoyer: „Wir müssen wieder lernen zu träumen, dafür brauchen wir Freiräume im Alltag, Gespräche mit Fremden, ein Spaziergang, die Zeit, einfach vor sich hinzudenken. Das macht uns empfindlich für Anregungen, die keinem Effizienz-Ziel folgen. Alles läuft ins Leere – und das tut gut.“